Die Jagd befindet sich im Wandel. Der technologische Fortschritt macht auch vor dem Revier nicht halt. Besonders die Diskussion um Nachtzieltechnik hat in den letzten Jahren deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Juni 2025 hat der Bundesrat einer Gesetzesänderung zugestimmt, die den Einsatz von Nachtzieltechnik im Rahmen der Jagd bundesweit zulassen soll. Eine endgültige Entscheidung steht jedoch noch aus, da auch der Bundestag der Änderung zustimmen muss. Sollte es zur Ratifizierung kommen, wären die Konsequenzen für Jägerinnen und Jäger, Wildbestände, Wildschadensregulierung und ethische Fragen erheblich. Doch was genau würde diese Freigabe bedeuten? Welche Technik wäre erlaubt, welche Voraussetzungen müssten erfüllt sein und wie steht es um die Waidgerechtigkeit? Dieser Artikel liefert einen umfassenden Überblick.
Gesetzeslage: Noch nicht in Kraft, aber auf dem Weg
Die rechtlichen Grundlagen der Nachtzieltechnik waren bis vor Kurzem ein Flickenteppich. In einigen Bundesländern war der Einsatz von Vorsatz- und Nachsatzgeräten bereits erlaubt, in anderen nicht. Dies sorgte nicht nur für Unsicherheit bei den Jägern, sondern auch für Ungleichheit in der Schwarzwildbejagung. Mit der Zustimmung des Bundesrats vom 13. Juni 2025 wurde ein wichtiger Schritt in Richtung einer einheitlichen Regelung gemacht. Die endgültige Entscheidung liegt nun beim Bundestag. Sollte dieser zustimmen, wäre der Einsatz von Nachtzieltechnik bundesweit zulässig, allerdings unter bestimmten Voraussetzungen: Der Jäger müsste im Besitz eines gültigen Jagdscheins sein, das Gerät müsste den technischen Anforderungen entsprechen und der Einsatz wäre ausschließlich zur Bejagung von Schwarzwild gestattet. Eine Erweiterung auf andere Wildarten ist aktuell nicht vorgesehen.
Darüber hinaus bliebe die Waffenrechtskomponente zu beachten, da auch hier Bedarf einer Gesetzesänderung vorherrscht. Eine gesonderte Genehmigung für das Führen dieser Technik wäre nicht mehr notwendig, jedoch empfiehlt der Deutsche Jagdverband (DJV) dringend eine Schulung oder Einweisung, um die Technik waidgerecht und sicher einsetzen zu können. Auch Landesjagdgesetze könnten weiterhin spezifische Einschränkungen enthalten, weshalb eine Überprüfung der jeweils gültigen Regelungen vor Ort ratsam bleibt.
Vorteile: Effizienz, Sicherheit und Seuchenschutz
Bei der Vorteilhaftigkeitsabwägung des Einsatzes von Nachtzieltechnik, ist dies nahezu deckungsgleich mit dem Einsatz von Vorsatztechnologie. Zudem ergeben sich aus der Sicht des BKA durch den Einsatz von Nachtzieltechnologie nur wenige Unterschiede zu der bereits erlaubten Vorsatztechnologie. In der Praxis würde die Freigabe der Nachtzieltechnik vor allem eins bedeuten: eine deutlich effektivere Bejagung von Schwarzwild. Gerade in Regionen, die stark von Wildschäden betroffen sind, stellt die Technik eine wertvolle Hilfe dar. Durch die verbesserte Sicht in der Dunkelheit könnten Jäger Wildpräsenz besser erkennen, gezielt ansprechen und treffsicher schießen. Dies fördert nicht nur die Effizienz der Jagd, sondern trägt auch zur Wildbretschonung bei. Trefferlage und Schusswirkung lassen sich mit Nachtzieltechnik besser kontrollieren, was wiederum das Tierleid minimiert und die Waidgerechtigkeit unterstützt.
Ein weiterer Vorteil liegt im Seuchenschutz. Die Ausbreitung der Afrikanischen Schweinepest (ASP) stellt eine erhebliche Bedrohung für Wild- und Hausschweinbestände dar. Eine effektive Reduktion der Schwarzwildpopulation ist ein zentrales Element im Kampf gegen die ASP. Nachtzieltechnik kann hier entscheidend beitragen, insbesondere durch die Bejagung in den Nachtstunden, wenn die Tiere besonders aktiv sind.
Nachteile und Kritik: Ethik und Technikabhängigkeit
Trotz dieser Vorteile gibt es auch kritische Stimmen. Jagdethisch stellt sich die Frage, ob die Verwendung solcher Technik noch mit der traditionellen Waidgerechtigkeit vereinbar ist. Gegner der Technik befürchten, dass der Jagddruck erhöht wird, das Wild dauerhaft vergrämt und natürliches Verhalten gestört wird. Auch der Vorwurf, dass Technik zunehmend jagdliche Erfahrung und Können ersetzt, steht im Raum. Der Umgang mit moderner Technik sollte daher stets mit Bedacht erfolgen und darf nicht dazu führen, grundlegende Prinzipien der Jagd zu vernachlässigen.
Darüber hinaus besteht das Risiko einer technischen Überreizung. Hochauflösende Geräte mit digitalen Zielhilfen könnten verleiten, auch in Situationen zu schießen, in denen eine saubere Ansprechung fraglich ist. Es liegt in der Verantwortung jedes einzelnen Jägers, hier mit Zurückhaltung und Verantwortungsbewusstsein zu agieren. Ebenso muss der Datenschutz beachtet werden, wenn Geräte mit Aufzeichnungsfunktion eingesetzt werden. Entscheidet man sich für die Anschaffung eine Nachtzieloptik ist man dieser Optik-Büchsen-Kombination auf die Bejagung von Schwarzwild beschränkt. Möchte man die Nachtzieloptik mit eine Wechselmontage versehen, um diese auf weiteren Büchsen einzusetzen, erhält man ähnlich Unwegsamkeiten, wie dem Einsatz von Vorsatztechnologie.
Erfahrungen aus dem Revier: Stimmen der Jägerschaft
Die Stimmen aus der Praxis sind bislang gemischt, aber tendenziell positiv. Viele Jäger berichten, dass sie durch die Technik sicherer schießen und weniger Nachsuchen notwendig sind. Gerade in Revieren mit hohem Schwarzwildbesatz wird die Nachtsichtvorsatztechnologie als Erleichterung empfunden. Kritisch wird jedoch angemerkt, dass manche Jäger sich auf die Technik verlassen, ohne sich zuvor ausreichend mit den Funktionen und Grenzen vertraut gemacht zu haben. Hier ist Weiterbildung gefragt. Jagdschulen und Verbände bieten zunehmend Schulungen an, die sowohl technische als auch rechtliche und ethische Aspekte behandeln. Auf der rechten Seite finden Sie einen Onlinekurs der Akademie für Jäger und Sportschützen zu dem Thema mit einem entsprechenden Rabattcode.
Gesellschaftliche Diskussion: Jagd unter Beobachtung
Der gesellschaftliche Diskurs um den Einsatz von Nachtzieltechnik spiegelt sich auch in den Medien und politischen Debatten wider. Während Vertreter der Landwirtschaft und Forstwirtschaft die Technik als notwendiges Mittel zur Wildschadensvermeidung sehen, äußern sich Tierschutzverbände skeptisch. Wichtig ist daher ein transparenter Umgang mit der Technik, der auch die nicht-jagende Öffentlichkeit mitnimmt. Die Jagd steht unter Beobachtung, und nur durch verantwortungsvolles Handeln kann das Vertrauen in die Jägerschaft gestärkt werden.
Fazit: Verantwortung statt Technikgläubigkeit
Abschließend lässt sich sagen: Die mögliche Freigabe von Nachtzieltechnik ist ein Meilenstein in der modernen Jagdpraxis. Sie bietet klare Vorteile in Bezug auf Effizienz, Tierwohl und Seuchenschutz, erfordert aber gleichzeitig ein hohes Maß an Verantwortung, Fachwissen und ethischer Reflexion. Die Technik allein macht keinen guten Jäger. Erst das Zusammenspiel aus Erfahrung, Respekt vor dem Wild und bewusster Techniknutzung sorgt dafür, dass die Jagd auch im digitalen Zeitalter waidgerecht bleibt. Aus unserer Bewertung heraus hat der Einsatz von Nachtzieltechnologie nur wenig mehr Vorteile gegenüber dem Einsatz von Vorsatztechnologie, wodurch Nachtzieltechnologie zwar einen Platz auf dem Optikmarkt findet wird aber nicht revolutioniert.
Checkliste für Jäger: Einstieg in die Nachtzieltechnik
Für interessierte Jäger empfiehlt sich zum Einstieg eine einfache Checkliste: Zunächst sollte die lokale Rechtslage geprüft werden. Anschließend ist es wichtig, sich über die Gerätetypen zu informieren und ggf. Testmöglichkeiten zu nutzen. Eine technische Schulung oder der Besuch eines Seminars zur waidgerechten Anwendung kann helfen, Fehler zu vermeiden. Nicht zuletzt sollte jeder Jäger sich selbst fragen, in welchen Situationen er die Technik einsetzen möchte – und in welchen bewusst nicht. Denn am Ende bleibt die Jagd eine Verantwortung, die weit über das Ziel hinausgeht.







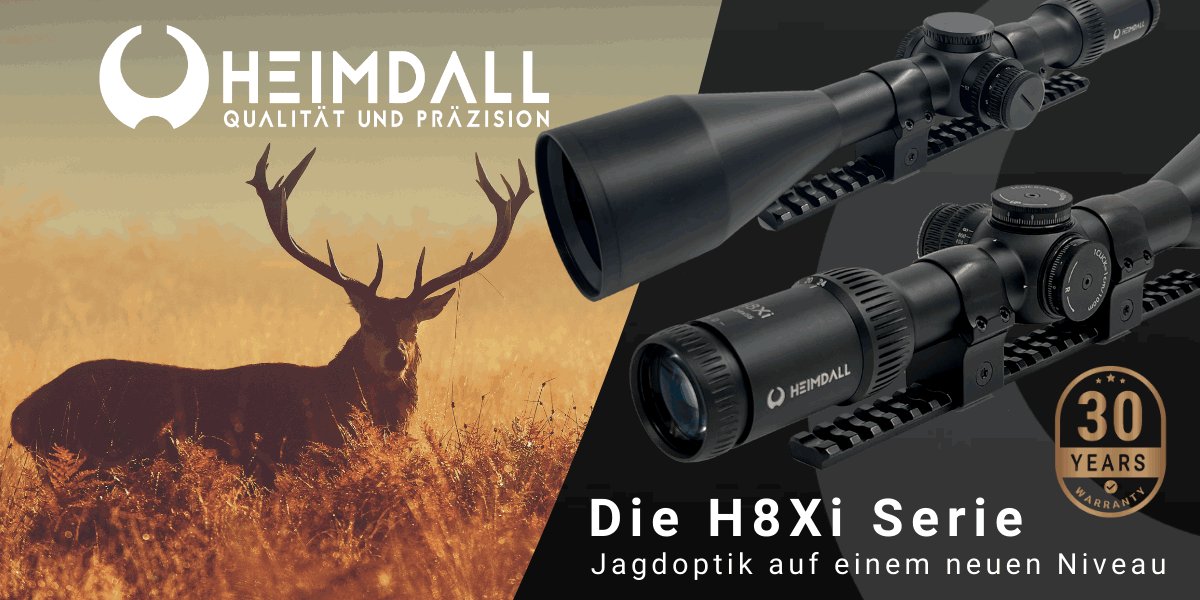















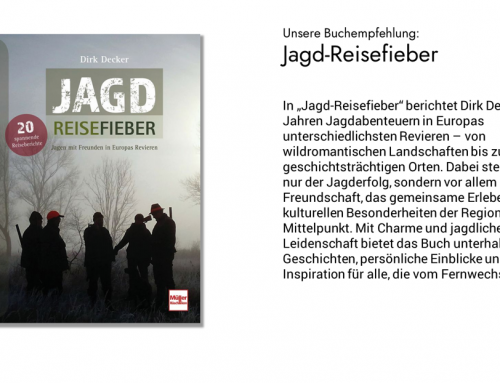
Hinterlasse einen Kommentar